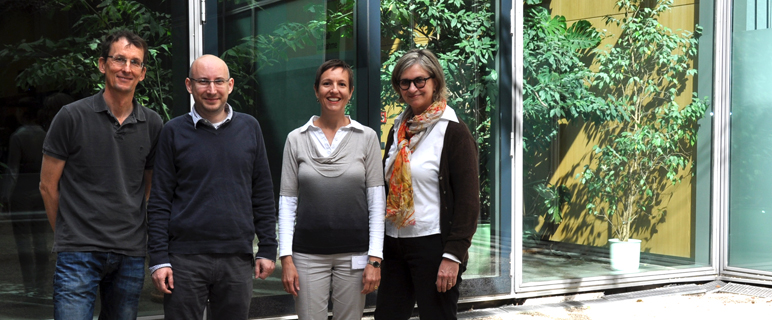FWF fördert vier neue Projekte an der Medizinischen Universität Innsbruck
Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Österreichs zentrale Einrichtung zur Unterstützung der Grundlagenforschung, hat in seiner 43. Kuratoriumssitzung Anfang Mai vier Forschungsprojekte von Forscherinnen und Forschern der Medizinischen Universität Innsbruck bewilligt. Die ProjektleiterInnen sind ao.Univ.-Prof.in Gabriele Baier-Bitterlich, Univ.-Doz. Clemens Decristoforo, ao.Univ.-Prof.in Florentine Marx-Ladurner und Assistenzprofessor Ramon Osman Tasan PhD.
Das Kuratorium des Wissenschaftsfonds, das sich aus dem Präsidium des FWF und den FachreferentInnen zusammensetzt, hat in seiner letzten Sitzung die Unterstützung von vier Forschungsvorhaben der Medizinischen Universität Innsbruck beschlossen und ermöglicht damit die Realisierung von wissenschaftlich hochqualitativen Projekten auf internationalem Niveau.
Neue Einsichten in neuroprotektive Prozesse
Purinnukleoside - neuroprotektive Moleküle - erfüllen als endogene Botenstoffe eine wichtige Funktion für den Schutz bzw. die potentielle Regeneration von Nervenzellen unter besonderen Belastungen, wie etwa einem Gehirnschlag. Als Vermittler von zellulären Signaltransduktionswegen in hypoxischen Neuronen stehen sie im Forschungsfokus von ao.Univ.-Prof.in Gabriele Baier-Bitterlich von der Sektion für Neurobiochemie des Biozentrums. Die kürzlich durch ihre Arbeitsgruppe erfolgte Identifizierung einer Kandidatenrolle für die Purinnukleosid-vermittelte Proteinkinase C-verwandte Kinase 1 (PRK1/PKN1) in der Regulation von neuroprotektiven Prozessen bildet nun die Grundlage für das geförderte FWF-Projekt. „Mit der Aufklärung der präzisen PRK1-assoziierten molekularen Mechanismen in der Schutzfunktion von Neuronen, werden wir Hinweise auf eine potentiell kritische Rolle der PRK1 in neuroprotektiven Prozessen hinterfragen“, beschreibt Prof.in Baier-Bitterlich das wesentliche Projektziel. Weiters soll ein in vivo Schlaganfallmodel in PRK ‚Knockoutmäusen’ etabliert werden. Die Nutzung von genetischen Mausmodellen in Kombination mit Techniken aus Biochemie, siRNA-vermittelten Knockdown und Zellbiologie stellt dabei einen innovativen Forschungsansatz dar.
Sektion für Neurobiochemie
Neue Möglichkeiten in der nuklearmedizinischen Diagnostik
Das Projekt von Univ.-Doz. Dr. Clemens Decristoforo, Radiopharmazeut an der Univ.-Klinik für Nuklearmedizin, erforscht neue Möglichkeiten zur Herstellung hochspezifischer radioaktiv markierter Biomoleküle und deren Eigenschaften für die Anwendung in der Molekularen Bildgebung mittels Positronenemissionstomographie (PET). Diese Methode ermöglicht die bildgebende Darstellung pathophysiologischer Prozesse auf molekularer Ebene mit unerreichter Empfindlichkeit. In der onkologischen Diagnostik hat neben dem Einsatz von (F-18) 2-Fluordesoxyglucose vor allem Gallium-68 (68Ga, Halbwertszeit 68min) für die Markierung von Radiopharmaka an Bedeutung gewonnen. Auch 89Zr hat in den letzten Jahren Interesse für die Anwendung in der PET gefunden und erlaubt mit einer Halbwertszeit von 78,4 Stunden die Bildgebung von biologischen Targets Tage nach Applikation. „Dieses Projekt hat - in Zusammenarbeit mit der Universität Nijmegen und der Universität Uppsala - das Ziel“, so Projektleiter Decristoforo, „selektierte Peptid-Siderophore (kleine eisenbindende Moleküle), als Basis für das Design, die Synthese und Evaluierung von zielgerichteten Biomolekülen für die Markierung mit 68Ga und 89Zr zu etablieren“.
Univ.-Klinik für Nuklearmedizin
Neue antifungale Strategien in der Medizin
Die dramatische Zunahme von Infektionen durch opportunistische humanpathogene Pilze, das erhöhte, durch lebenserhaltende, aber gleichzeitig invasive medizinische Behandlungen begründete Risiko, an ansonsten harmlosen Pilzen zu erkranken sowie eine langsame, aber stete Entwicklung von therapieresistenten Pilzstämmen bei einer begrenzten Zahl von wirksamen Antimykotika bedingen die Suche nach neuen, antimykotischen Therapien sowie effizienten und kostengünstigen Strategien, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Natürlich vorkommende Substanzen mit antifungaler Wirkung stellen dabei einen vielversprechenden Ansatz dar, den auch das FWF-Projekt von ao.Univ.-Prof.in Florentine Marx-Ladurner, von der Sektion für Molekularbiologie verfolgt. Im Fokus steht dabei das kleine, kationische, Cystein-reiche und antifungale Protein PAF aus dem Schimmelpilz Penicillium chrysogenum. „Die antifungale Aktivität sowie der Umstand, dass PAF in vitro und in vivo keine negativen Effekte auf Mammaliazellen aufweist, machen PAF zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Entwicklung neuer und effizienter antifungaler Strategien“, so die Mikrobiologin, die nun den Wirkungsmechanismus von PAF im Detail untersuchen wird.
Sektion für Molekularbiologie
Neue Wege in der Angsttherapie
Angststörungen zählen zu den häufigsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems und stellen für die Gesellschaft eine große sozioökonomische Belastung dar. In den vergangenen Jahren konnte ein Zusammenhang zwischen emotionalen Lernvorgängen und der Entstehung neuer Nervenzellen im adulten Gehirn hergestellt werden. Rezente Forschungen weisen auf eine wichtige Funktion von Neuropeptiden in der Regulation von Angst hin. Hier setzt das FWF-Projekt des Neuropharmakologen Dr. Ramon Tasan, PhD an, der die Bedeutung von NPY - ein 36 Aminosäuren langer peptiderger Neurotransmitter - und insbesondere seines Y2 Rezeptors in der adulten Neurogenese genauer erforschen will: „Wir werden sowohl die Expression als auch die Funktion des Y2 Rezeptors während der Entwicklung neugebildeter Nervenzellen im adulten Hippocampus histochemisch, elektronenmikroskopisch, eletrophysiologisch und mittels Verhaltensversuchen (Angst Konditionierung) untersuchen“. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen, die Bedeutung der kontinuierlichen Neurogenese im Erwachsenengehirn zu charakterisieren und damit spezifisch die Funktion dieser jungen Nervenzellen für die Entstehung von emotionalen Lernvorgängen zu erfassen.
Institut für Pharmakologie
(D.Heidegger)
Weiterer Link:
FWF